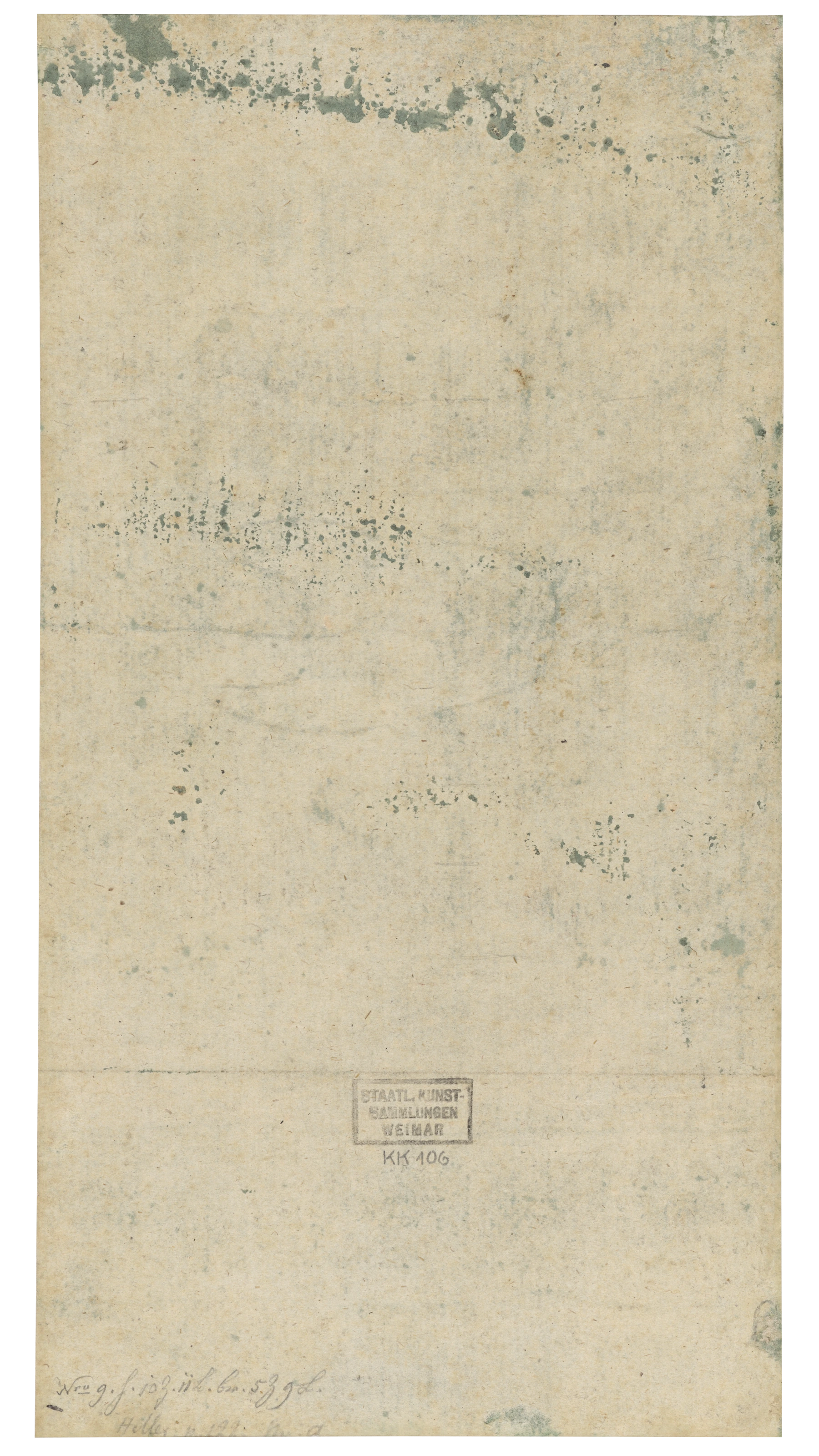Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Albrecht Dürer: Selbstbildnis als Akt, um 1509
In schonungsloser Nacktheit präsentiert sich Albrecht Dürer in seinem Selbstbildnis und zeigt damit das neue Selbstbewusstsein, mit dem die Künstler der Renaissance auftraten.
| Künstler | Dürer, Albrecht (1471-1528)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Titel |
Selbstbildnis als Akt
[ GND ] |
| Standort | derzeit nicht ausgestellt |
| Entstehungszeit | um 1509 |
| Objekttyp | Graphik |
| Material / Technik | Pinsel in Schwarz, Grau und Weiß, grün grundiertes Papier |
| Weitere Metadaten | |
|---|---|
| Höhe | 29,5 cm |
| Breite | 15,5 cm |
| Provenienz | alter Bestand |
| Haltende Einrichtung | Museen |
| Sammlung | Graphische Sammlungen |
| Bestand | Bestand |
| Inventar-Nr. | KK 106 |
| Links zum Objekt |
|---|
| Fotothek Online |
| Digitale Sammlungen der Museen |
| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |
Ehrlich und schonungslos offen wirkt die Zeichnung, in der Albrecht Dürer (1471–1528) sich selbst studierte – nackt, nur das Haar mit einer Haube zurückgebunden. Der Fokus liegt auf dem Kopf, dem Oberkörper, den Genitalien und dem Spiel der Muskeln.
Auf dem grün grundierten Papier sind die Konturen und Schattierungen schwarz angelegt, die Lichtreflexe weiß aufgetragen. Damit erzielt Dürer eine plastische Wirkung. Diese Art zu zeichnen war damals modern. Dürer kannte sie wahrscheinlich aus Venedig, einem der führenden Kunstzentren seiner Zeit. Ebenso modern war es, das eigene Bildnis als Kunstwerk zu begreifen. Geradezu unerhört war es aber, sich nackt zu zeigen, da Nacktheit mit Gefühlen von Scham und Ehrlosigkeit sowie mit Armut verbunden wurde.
So momenthaft die Zeichnung wirkt, so wohlüberlegt ist sie. Die Arme fehlen nicht zufällig, denn dies war typisch für die antiken Skulpturen, die an den Höfen der Renaissance gesammelt wurden. Auch sie waren oft nackt, doch da es sich um kunstvoll gestaltete Idealkörper von Göttern und Helden handelte, wurde diese Nacktheit bewundert – zumindest von Kunstliebhabern und Gelehrten. Dürers Lichtführung wie bei Kerzenschein spielt zudem auf die Nacht als die Zeit geistig schöpferischer Menschen und damit auf das Selbstbild der Renaissance-Künstler an, die nicht mehr als einfache Handwerker gesehen werden wollten. So ist die Zeichnung ein Ausweis jenes neuen Selbstbewusstseins, mit dem Dürer und andere Maler seiner Zeit auftraten.