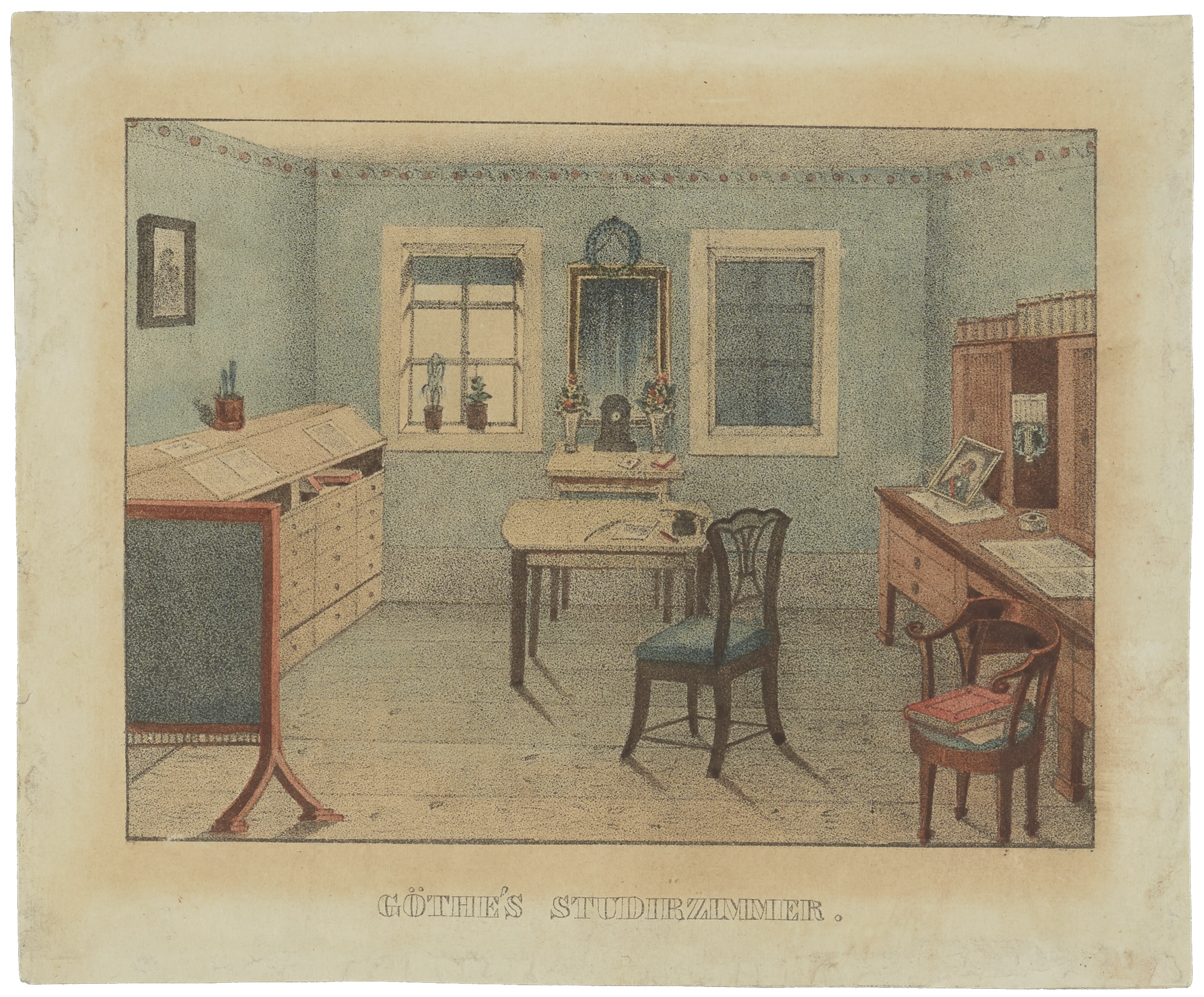Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Ehrenkranz zum 100. Geburstag Friedrich Schillers, 1859
Der silberne Ehrenkranz von 1859 ist Ausdruck einer auch politischen Dichterverehrung, die in Monumenten und Erinnerungsgaben ihren Niederschlag fand. Er entstand anlässlich der Feierlichkeiten zu Schillers 100. Geburtstag.
| Jubilar | Friedrich Schiller (1759–1805)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Titel | Ehrenkranz zum 100. Geburstag Friedrich Schillers |
| Standort | Schiller-Museum Bauerbach |
| Entstehungszeit | 1859 |
| Objekttyp | Kunstgewerbe |
| Material / Technik | Metall |
| Weitere Metadaten | |
|---|---|
| Höhe | 37,5 cm |
| Breite | 27,5 cm |
| Tiefe | 5,5 cm |
| Provenienz | in den 1980er Jahren aus dem Weimarer Stadtschloss an das Goethe-Nationalmuseum übergeben |
| Haltende Einrichtung | Museen |
| Sammlung | Kunstgewerbesammlung |
| Inventar-Nr. | Kg-2014/1675 |
| Links zum Objekt |
|---|
| Fotothek Online |
| Digitale Sammlungen der Museen |
| Schiller-Museum Bauerbach |
| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |
Schon kurz nach seinem Tod wurde Friedrich Schiller (1759–1805) in Deutschland verehrt wie kein anderer Dichter zuvor. Insbesondere die bürgerlich-liberale Opposition stilisierte ihn im monarchistisch geprägten Deutschland zum Freiheitsdichter. Vor allem im Vorfeld der Revolution von 1848 wurde Schiller zum Propheten eines geeinten Vaterlands verklärt.
Schillers Idee der Kunst war bei dieser Politisierung zweitrangig; nicht selten beruhte die Rezeption auf Schlagworten. So wenig diese Parolen Schillers vielfältigem Werk gerecht wurden, so einflussreich waren sie, etwa das berühmte „Geben Sie Gedankenfreiheit“. Mit diesen Worten fordert im „Don Karlos“ der Marquis von Posa gegenüber dem absolutistisch herrschenden König Philipp II. die freie Meinungsäußerung als ein vom Staat zu schützendes Naturrecht ein. „Don Karlos“ wurde so zu einem Signum der frühen deutschen Demokratiebewegung.
Zu Schillers 100. Geburtstag im Jahr 1859 erreichte die Identifikation der Deutschen mit ihrem Nationaldichter einen Höhepunkt. Das gebildete Bürgertum, Studenten und Handwerkerverbände, aber auch Arbeiter, verwirklichten gemeinsam gegen die monarchistische Obrigkeit groß angelegte Dichterfeiern, Festumzüge und Denkmäler zu Ehren Schillers. In diesen Kontext gehört auch der silbern gewirkte Kranz von Eichenblättern. Die Huldigungsgabe zeigt, dass der Dichterkult nationalreligiöse Züge annahm. In der Verehrung Schillers erschien das politisch zerrissene Deutschland geeint.