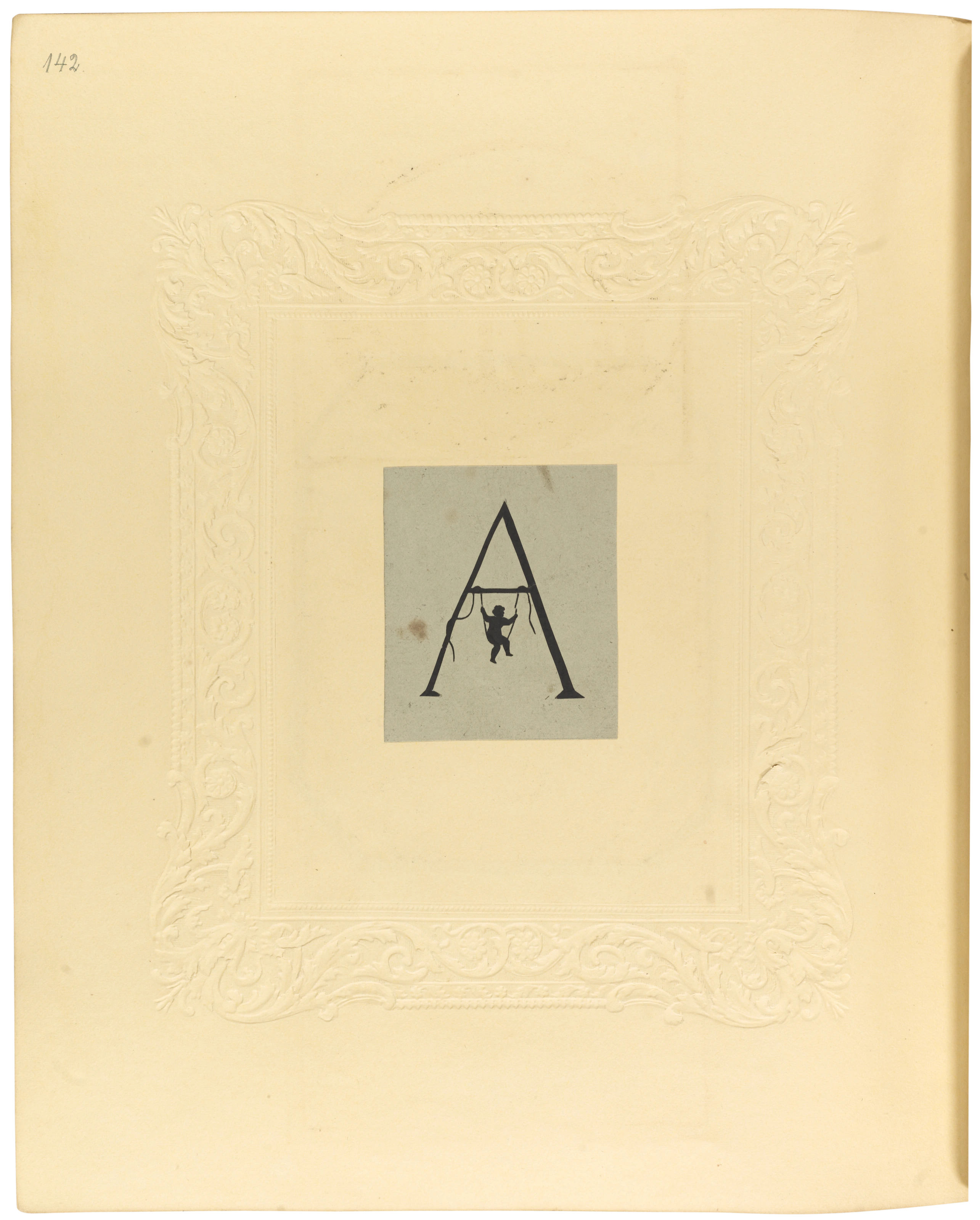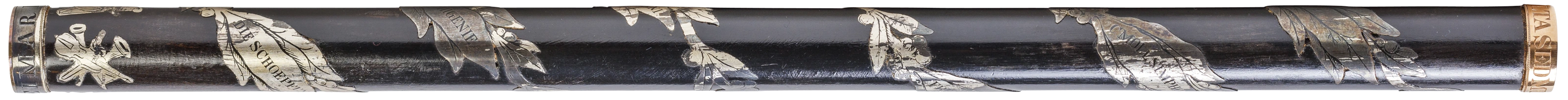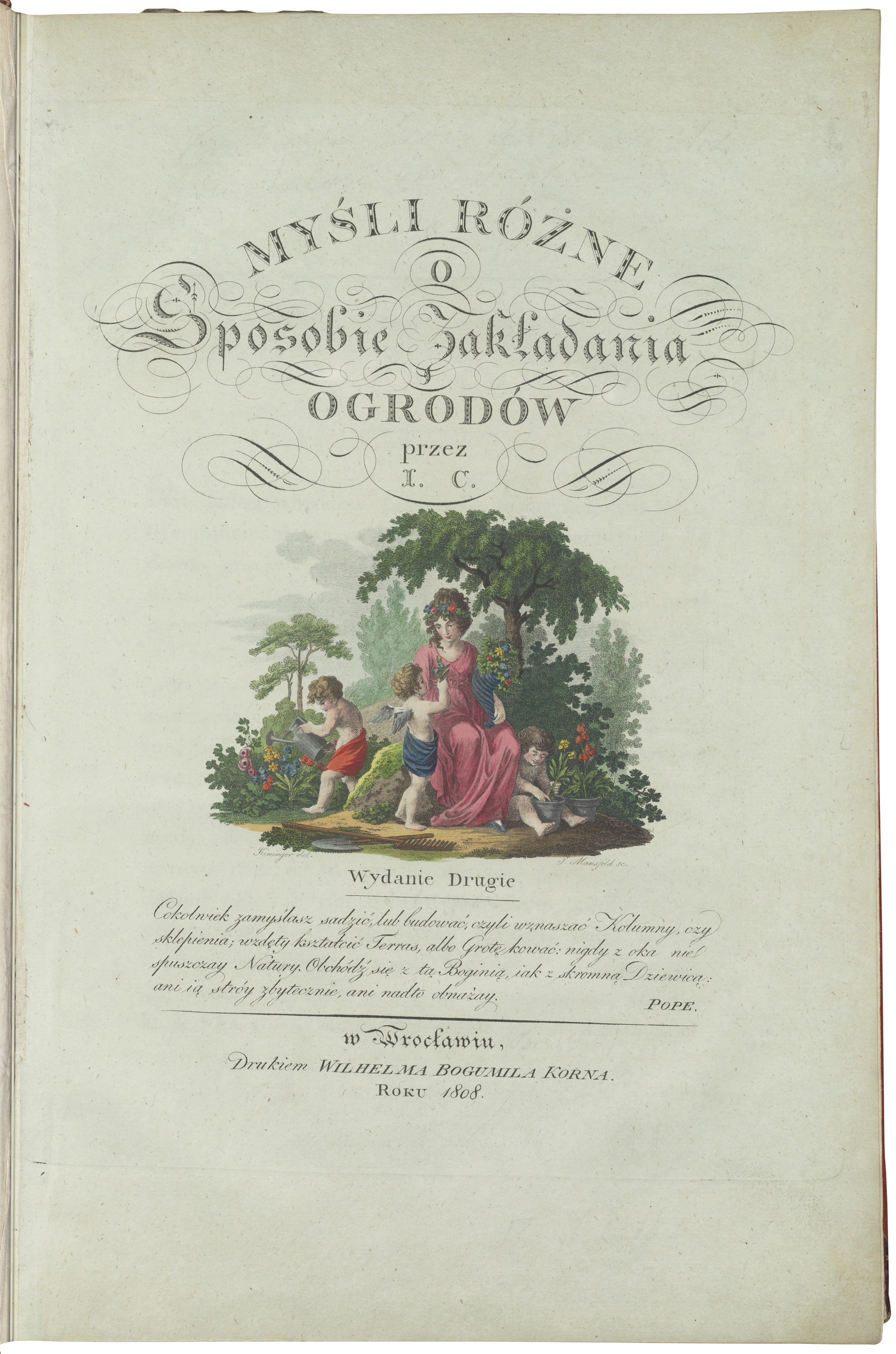Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Johann Friedrich August Tischbein: Porträt Erbprinzessin Maria Pawlowna von Sachsen-Weimar-Eisenach, 1805
Am 9. November 1804 traf die Zarentocher und spätere Großherzogin Maria Pawlowna unter großer medialer Aufmerksamkeit in Weimar ein. In kurzer Zeit entstanden unzählige Bilder der jungen Fürstin, die sich von den Porträtsitzungen bald ermüdet zeigte.
| Künstler | Johann Friedrich August Tischbein (1750–1812)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Titel |
Porträt Erbprinzessin Maria Pawlowna von Sachsen-Weimar-Eisenach
[ GND ] |
| Standort | derzeit nicht ausgestellt |
| Entstehungszeit | 1805 |
| Objekttyp | Gemälde |
| Material / Technik | ölhaltige Farben auf Leinengewebe |
| Weitere Beteiligte | |
|---|---|
| Dargestellte | Großherzogin Maria Pawlowna von Sachsen-Weimar-Eisenach (1786–1859)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Weitere Metadaten | |
|---|---|
| Höhe | 184,0 cm |
| Breite | 125,0 cm |
| Provenienz | 1805 Auftragswerk der Weimarer Bürgerschaft, nach 1945 aus städtischem Besitz an die Kunstsammlungen zu Weimar übergeben |
| Haltende Einrichtung | Museen |
| Sammlung | Gemäldesammlung |
| [ GND ] | |
| Inventar-Nr. | G 1055 |
| Links zum Objekt |
|---|
| Fotothek Online |
| Digitale Sammlungen der Museen |
| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |
Prinz Carl Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach hatte Maria Pawlowna (1786-1859), die Tochter Zar Pauls I., 1803 in St. Petersburg geheiratet. Für Herzog Carl August war diese dynastische Verbindung ein großer Erfolg zur Sicherung seines Fürstentums in den politischen Umbrüchen der Napoleonischen Zeit.
Bereits die Hofmaler in St. Petersburg hatten verschiedene Porträts der russischen Großfürstin angefertigt. In Weimar entstand schon bald eine Büste, die zu den Frühwerken Friedrich Tiecks zählt. Gleichzeitig arbeitete Johann Friedrich August Tischbein (1750–1812) an einem für das Weimarer Rathaus bestimmten Gemälde, das Maria Pawlowna im Ornat ihrer Würde als „Kaiserliche Hoheit“ zeigt. Das als Staatsporträt angelegte Kniestück in Lebensgröße weist eine mehrschichtige Ikonographie auf. In leicht grell wirkender Malweise, die sich von der warmen Farbigkeit anderer Tischbein-Gemälde unterscheidet, erscheint die Großfürstin im Hermelinmantel mit juwelenbesetztem Diadem und der roten Schärpe mit dem Stern des russischen Katharinen-Ordens.
Maria Pawlownas Hände weisen auf Attribute des Bildempfängers: Auf dem Tisch liegen, von Blumengebinden umkränzt, die Statuten der Stadt Weimar; im Hintergrund erscheint die Figur der Justitia, die im Kleinen Saal des Rathauses die Wahrung der Bürgerrechte verkörperte. Das Porträt spiegelt somit die Erwartungen der Weimarer Bürgerschaft an die neue Fürstin, denn das Verhältnis von fürstlichem Anspruch und bürgerlichen Rechten sollte in den folgenden Jahrzehnten neu verhandelt werden.