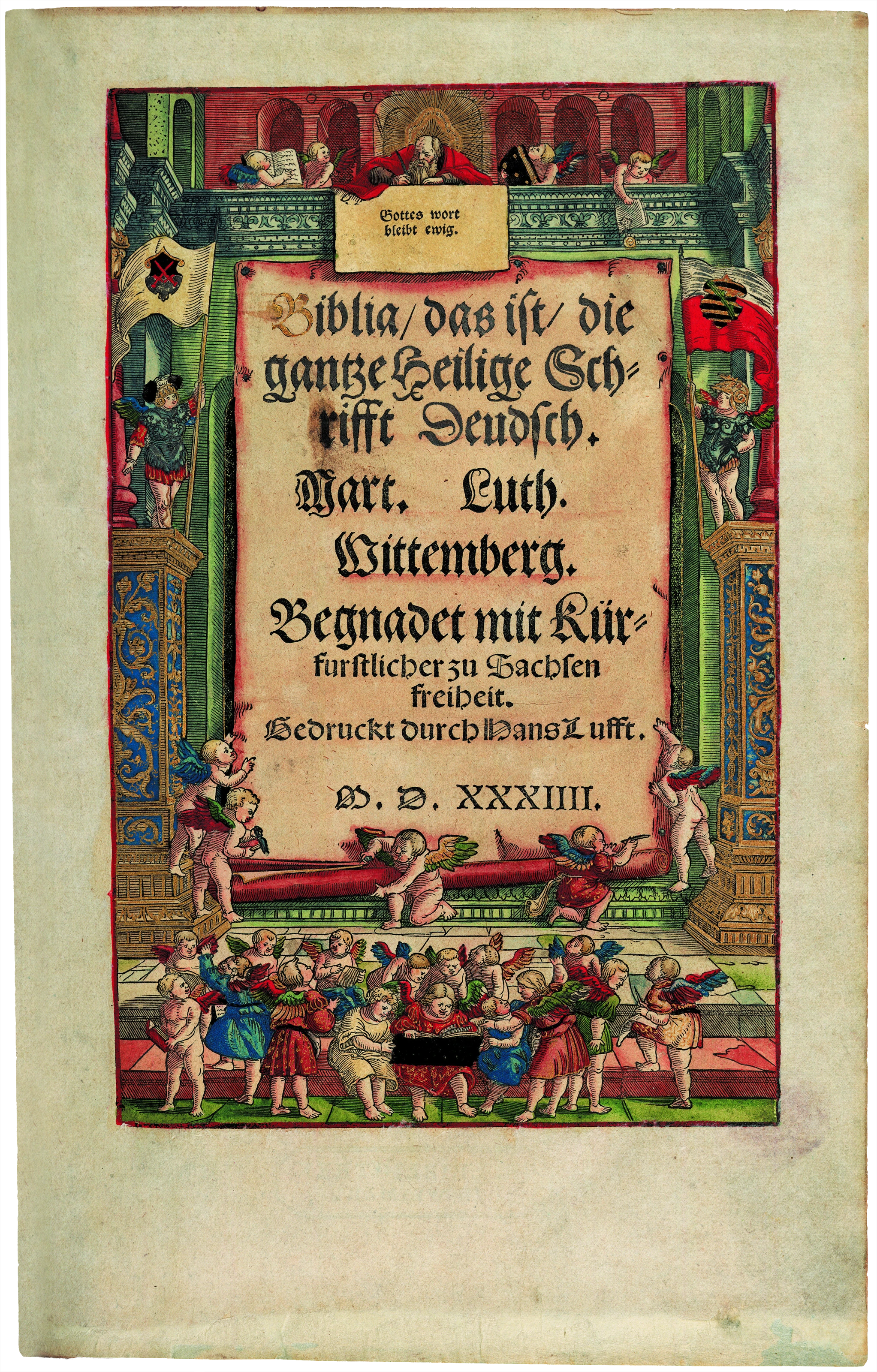Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Monogrammist H G: Medaille auf Martin Luther, 1521
Im Jahr 1521 weigerte sich Martin Luther, seine Lehren zu widerrufen. Seine Person wie auch sein Protest wurden zu einem frühen Medienereignis. Auch diese Silbermedaille half dabei, seinen Ruhm zu verbreiten und bot wortwörtlich Luther zum Anfassen.
| Künstler | Monogrammist H G
[ GND ] [ so:fie ] |
| Titel | Medaille auf Martin Luther |
| Standort | derzeit nicht ausgestellt |
| Entstehungszeit | 1521 |
| Objekttyp | Medaille |
| Material / Technik | Silber, Guss |
| Weitere Beteiligte | |
|---|---|
| Künstler der Vorlage | Lucas Cranach d.Ä. (1472–1553)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Dargestellter | Martin Luther (1483–1546)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Weitere Metadaten | |
|---|---|
| Höhe | 0,4 cm |
| Durchmesser | 6,7 cm |
| Provenienz | Übernahme aus dem Bestand der Thüringischen Landesbibliothek Weimar |
| Haltende Einrichtung | Museen |
| Sammlung | Münzen- und Medaillensammlung |
| Inventar-Nr. | MM-2019/25 |
| Links zum Objekt |
|---|
| Fotothek Online |
| Digitale Sammlungen der Museen |
| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |
1521 war ein Schicksalsjahr Martin Luthers (1483–1546). Er verteidigte in Worms seine Schriften, in denen er die Missstände in der katholischen Kirche anprangerte. Seine Weigerung, zu widerrufen („Hier stehe ich und kann nicht anders“), wurde zur Parole der Reformation. In diesem Zusammenhang entstand ein Kupferstich von Lucas Cranach d.Ä. (1472–1553), der als Vorlage der Silbermedaille diente. Sie zeigt Luther im Profil mit einer Kutte und einem Doktorhut. Ringsum läuft ein lateinischer Zweizeiler, der ihn verteidigt und übersetzt lautet: „Wenn Luther irgendwelcher Ketzereien schuldig sein wird, so wird auch Christus dieses Verbrechens schuldig sein.“
Am unteren Rand der Medaille finden sich die Initialen „H G“. Vielleicht arbeitete der unbekannte Medailleur nach Cranachs Kupferstich, vielleicht legte ihm dieser selbst ein plastisches Modell vor. Von der Medaille existieren mehrere Varianten. Das Weimarer Exemplar zeichnet sich durch einen besonders schön gearbeiteten Rand und ein vergleichsweise weich gestaltetes Profil aus. Nach Weimar gelangte die Medaille im Jahr 1908 durch den Ankauf einer großen Sammlung, spezialisiert auf die Geschichte der Reformation, die so zu einem Schwerpunkt des großherzoglichen Münzkabinetts wurde.
Medaillen wie diese trugen ganz erheblich zu Luthers Popularität bei und wurden nicht weniger wertgeschätzt als Gemälde. Sie verbreiteten politische Botschaften in kostbarem Material und boten wortwörtlich Berühmtheiten zum Anfassen. Luther gilt heute sogar als die am häufigsten auf Medaillen abgebildete Person überhaupt.