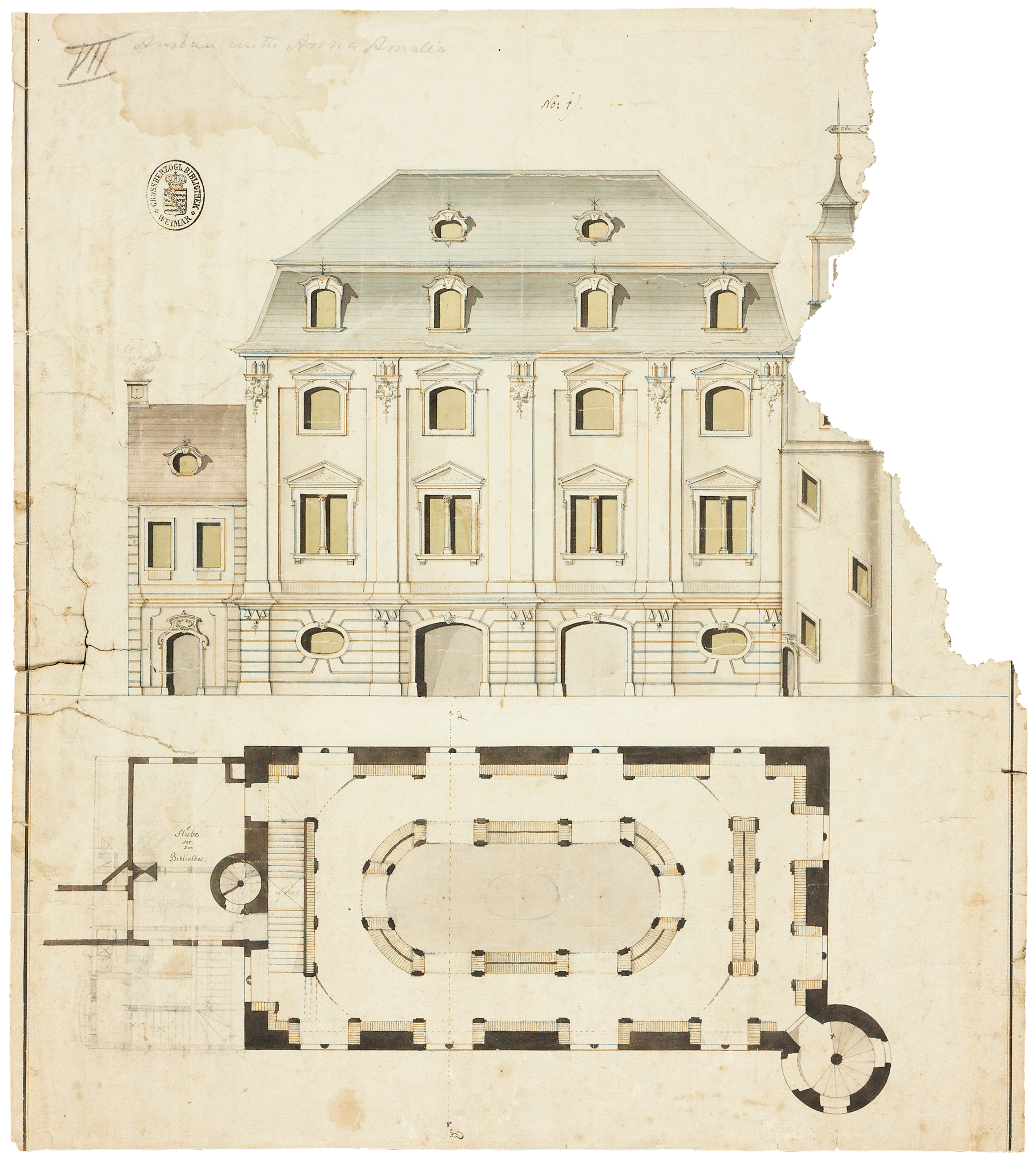Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Johann Friedrich August Tischbein: Porträt Christoph Martin Wieland, 1796
Der Dichter in der Landschaft – die Landschaft im Dichter. Ein empfindsames Gelehrtenporträt Christoph Martin Wielands, gemalt von Johann Friedrich August Tischbein.
| Künstler | Johann Friedrich August Tischbein (1750–1812)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Titel |
Porträt Christoph Martin Wieland
[ GND ] |
| Standort | Wittumspalais (Roter Salon) |
| Entstehungszeit | 1796 |
| Objekttyp | Gemälde |
| Material / Technik | ölhaltige Farben auf Leinengewebe |
| Weitere Beteiligte | |
|---|---|
| Dargestellter | Christoph Martin Wieland (1733–1813)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Weitere Metadaten | |
|---|---|
| Höhe | 93,0 cm |
| Breite | 70,8 cm |
| Provenienz | 2018 Schenkung Dr. Christa Brunner |
| Haltende Einrichtung | Museen |
| Sammlung | Gemäldesammlung |
| Inventar-Nr. | Ge-2017/4 |
| Links zum Objekt |
|---|
| Fotothek Online |
| Digitale Sammlungen der Museen |
| Wittumspalais |
| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |
1796 vollendete Johann Friedrich August Tischbein (1750–1812) ein außergewöhnliches Porträtgemälde des Weimarer Dichters Christoph Martin Wieland (1733–1813) an, das sich insbesondere durch seine Naturdarstellung auszeichnet. Das Ölgemälde galt lange als verschollen und war nur durch einen um 1800 entstandenen Kupferstich bekannt. Dank einer Schenkung ist es seit 2018 dauerhaft im Wittumspalais ausgestellt.
Entspannt sitzt der Dichter auf einer Bank im Grünen, sein Blick ist gedankenversunken. Das dichte Grün der Bäume, Pflanzen und Büsche umhüllt den Porträtierten, als säße er in einer Klause. Im linken oberen Mittelgrund des Bildes ist die Statuengruppe der „Drei Grazien“ zu erkennen, mit der Tischbein auf Wielands Versepos „Musarion, oder die Philosophie der Grazien“ (1768) anspielt, noch weiter im Hintergrund deutet sich die Skulptur einer liegenden Nymphe an. Kunst und Natur, die beiden Inspirationsquellen Wielands, ergänzen sich und bilden eine Einheit.
Das Wielandbildnis ist beispielhaft für den neuen Typus des empfindsamen Gelehrtenporträts, der sich um 1800 etablierte. Als Kniestück gestaltet, orientiert es sich an traditionellen Fürstenporträts, um den Geistesadel des Dargestellten zu demonstrieren. Auf die üblichen berufsbezogenen Gegenstände wie Bücher, Papiere und Feder wird zugunsten einer lockeren, möglichst natürlich wirkenden Pose verzichtet. Die Landschaft ist nicht inhaltsleeres Beiwerk, sondern nimmt Bezug auf das Wesen der dargestellten Person und macht deren Innenwelt sichtbar.