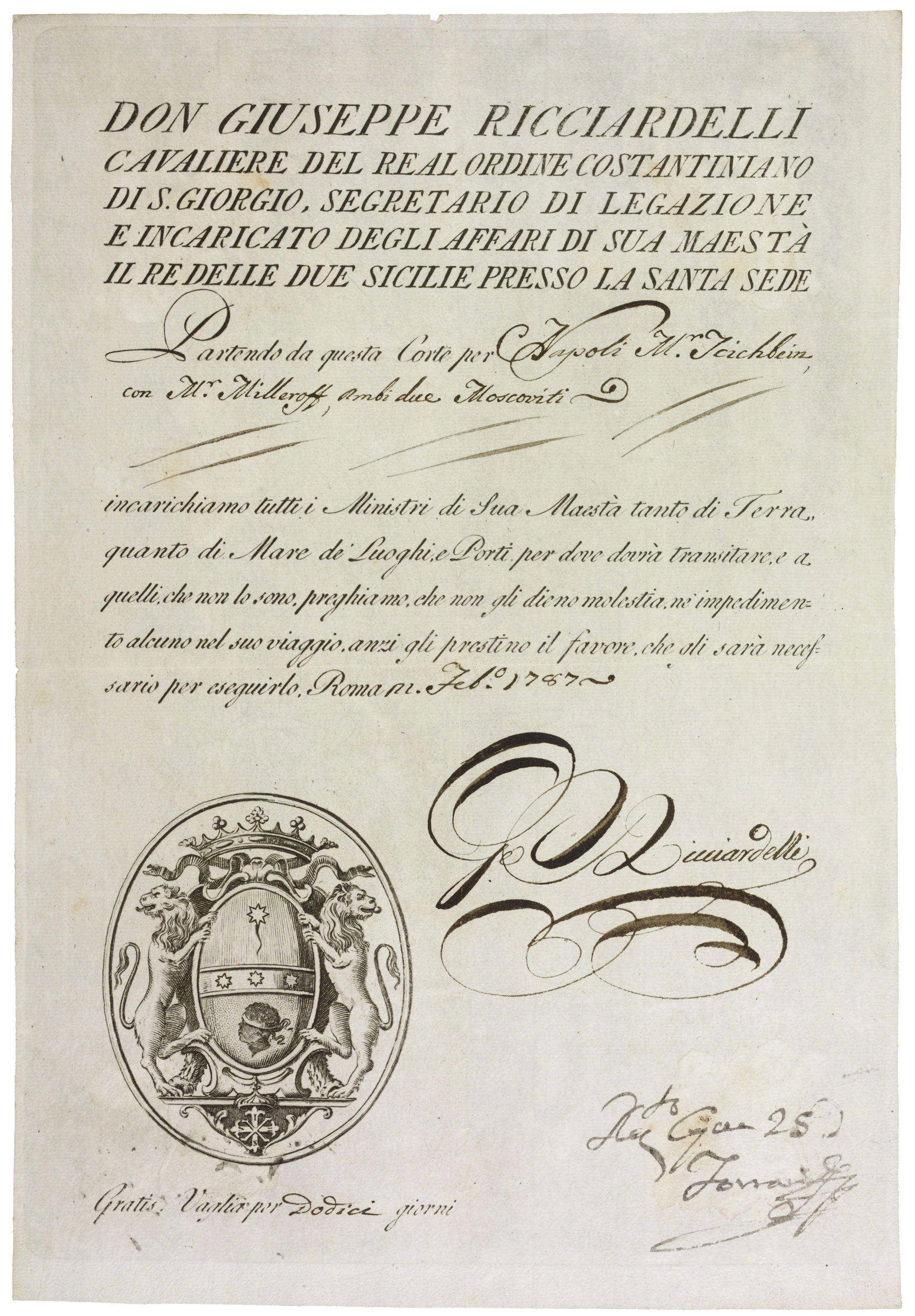Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Anton von Maron: Porträt Johann Joachim Winckelmann, 1768
Mit seinem Stilideal prägte Johann Joachim Winckelmann die Epoche des Klassizismus. Goethe und die Weimarischen Kunstfreunde gaben dem von Anton von Maron gemalten Porträt des Gelehrten einen Ehrenplatz in der Weimarer Gemäldegalerie.
| Künstler | Anton von Maron (1731–1808)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Titel |
Porträt Johann Joachim Winckelmann
[ GND ] |
| Standort | derzeit nicht ausgestellt |
| Entstehungszeit | 1768 |
| Objekttyp | Gemälde |
| Material / Technik | ölhaltige Farben auf Leinengewebe (Flachsfaser) |
| Weitere Beteiligte | |
|---|---|
| Dargestellter | Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Weitere Metadaten | |
|---|---|
| Höhe | 137,3 cm |
| Breite | 100,3 cm |
| Tiefe | 3,0 cm |
| Provenienz | 1805 von Erbherzog Carl Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach erworben |
| Haltende Einrichtung | Museen |
| Sammlung | Gemäldesammlung |
| Inventar-Nr. | G 70 |
| Links zum Objekt |
|---|
| Fotothek Online |
| Digitale Sammlungen der Museen |
| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |
Das 1768 von Anton von Maron (1731-1808) gemalte Gelehrtenporträt zeigt den berühmten Archäologen und Kunsttheoretiker Johann Joachim Winckelmann (1717–1768). Es war ein Auftragswerk des Barons von Muzel-Stosch, einem Freund Winckelmanns. Die Gestaltung bestimmte der Porträtierte selbst. Er wählte sowohl den ausführenden Maler als auch Bildausschnitt, Kleidung und die Requisite. Stilistisch orientiert sich das Gemälde an zeitgenössischen Adelsporträts fürstlicher Italienreisender.
Fast lebensgroß ist der fünfzigjährige Winckelmann im privaten Arbeitsumfeld dargestellt. Er trägt einen prächtigen rot-seidenen, pelzgefütterten Hausmantel und einen orangefarbenen Turban. In der rechten Hand eine Schreibfeder haltend, scheint der Porträtierte kurz im Schreiben zu pausieren. Die wachen Augen seines jung wirkenden Gesichts blicken dem Betrachter entgegen, während die linke Hand in milder Geste aus den Bildraum weist. Die Gegenstände im Bild zeugen von Winckelmanns Auseinandersetzung mit der Antike. Die auf dem Buch liegende Abbildung des Antinous-Reliefs aus der Sammlung des Kardinals Albani findet sich in Winckelmanns spätem Werk „Monumenti antichi inediti“ wieder. Aus der gleichen Sammlung stammt die rechts im Hintergrund sichtbare Büste des antiken Dichters Homer.
Wann das Porträt nach Weimar gelangte, ist unbekannt. 1809 kam es in das erste Weimarer Kunstmuseum im Fürstenhaus, 1825 in die Gemäldegalerie im Jägerhaus, wo die Vereinigung der Weimarischen Kunstfreunde es prominent im Zentrum der ersten Schauwand präsentierte.