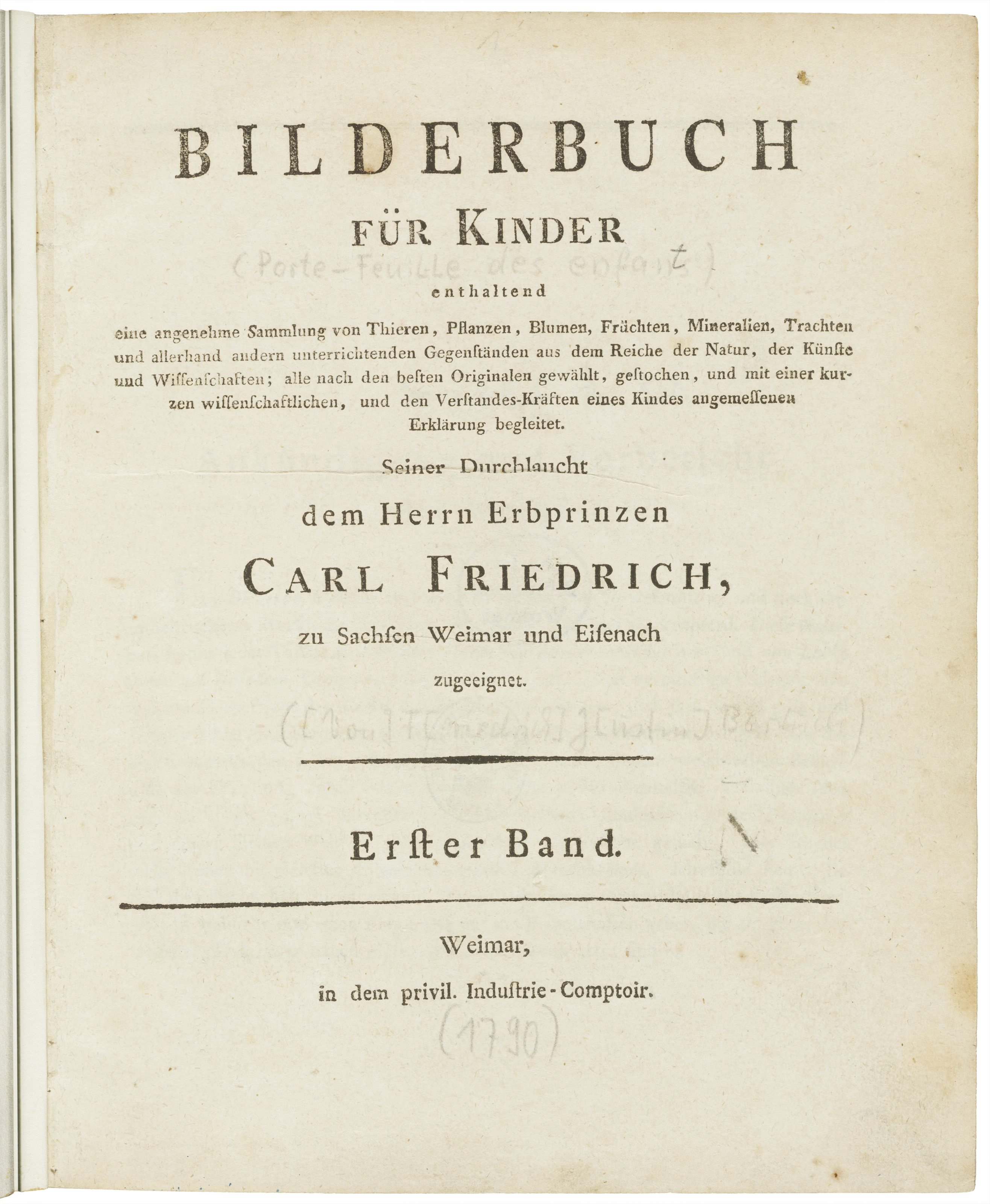Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Porzellanmanufaktur Wallendorf: Kaffeeservice für Christoph Martin Wielands Kinder, um 1800
Das Porzellanservice zeigt den Weimarer Dichter, Kosmopoliten und Zeitschriftenmacher Wieland von einer ganz persönlichen Seite – der des Vaters und Privatmenschen, der mit seiner Familie einen Gutshof in Oßmannstedt nahe Weimar bewohnte.
| Hersteller | Porzellanmanufaktur Wallendorf
[ GND ] [ so:fie ] |
| Titel | Kaffeeservice für Christoph Martin Wielands Kinder |
| Standort | Wielandgut Oßmannstedt |
| Entstehungszeit | um 1800 |
| Objekttyp | Kunstgewerbe |
| Material / Technik | Porzellan, Aufglasurmalerei |
| Weitere Beteiligte | |
|---|---|
| Besitzer | Christoph Martin Wieland Wieland (1733–1813)
[ GND ] [ so:fie ] |
| Weitere Metadaten | |
|---|---|
| Provenienz | 1933 Schenkung Elisabeth Hecht-Peucer (Wielands Urenkelin) |
| Haltende Einrichtung | Museen |
| Sammlung | Kunstgewerbesammlung |
| Inventar-Nr. | WKg/00512.1 – WKg/00512.12 |
| Links zum Objekt |
|---|
| Fotothek Online |
| Digitale Sammlungen der Museen |
| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |
Christoph Martin Wieland (1733–1813) war der älteste der vier großen Weimarer Klassiker. Als Herzogin Anna Amalia den damals schon berühmten Schriftsteller im Jahr 1772 nach Weimar holte, nahm die Weimarer Klassik ihren Anfang. Wieland sollte dem heranwachsenden Thronfolger Carl August als Lehrer und intellektueller Gesprächspartner dienen. Zugleich wurde ihm Freiraum für literarische Aktivitäten eingeräumt. Diesen nutzte Wieland, um eine beispiellose Produktivität zu entfalten: Es entstanden umfangreiche Romane wie „Die Geschichte der Abderiten“ (1774) und „Aristipp und einige seiner Zeitgenossen“ (1800).
Das um 1800 von der Porzellanmanufaktur Wallendorf hergestellte Kaffee-, Tee- und Schokoladenservice, von dem elf Teile erhalten sind, wirft ein Licht auf den Familienvater und Privatmenschen Wieland, der das familiäre Leben schätzte. Von seinen vierzehn Nachkommen erreichten neun das Erwachsenenalter. Die Namen der Kinder zieren das weiß glasierte, mit braunen Rändern versehene Familienservice. Nach Wielands Tod blieb es im Besitz der Familie und wurde 1933 von Wielands Urenkelin dem Schiller-Museum gestiftet.
Damit ist es eines der wenigen verbliebenen Stücke aus Wielands Besitz. Bei einer Auktion nach seinem Tod im Jahr 1813 wurde sein Nachlass veräußert. Wielands Gutshof in Oßmannstedt, den dieser mit seiner großen Familie mehrere Jahre lang bewohnte und selbst bewirtschaftete, gilt als eines der schönsten Häuser der Klassik Stiftung. Hier hat der Dichter auch seine letzte Ruhe gefunden.