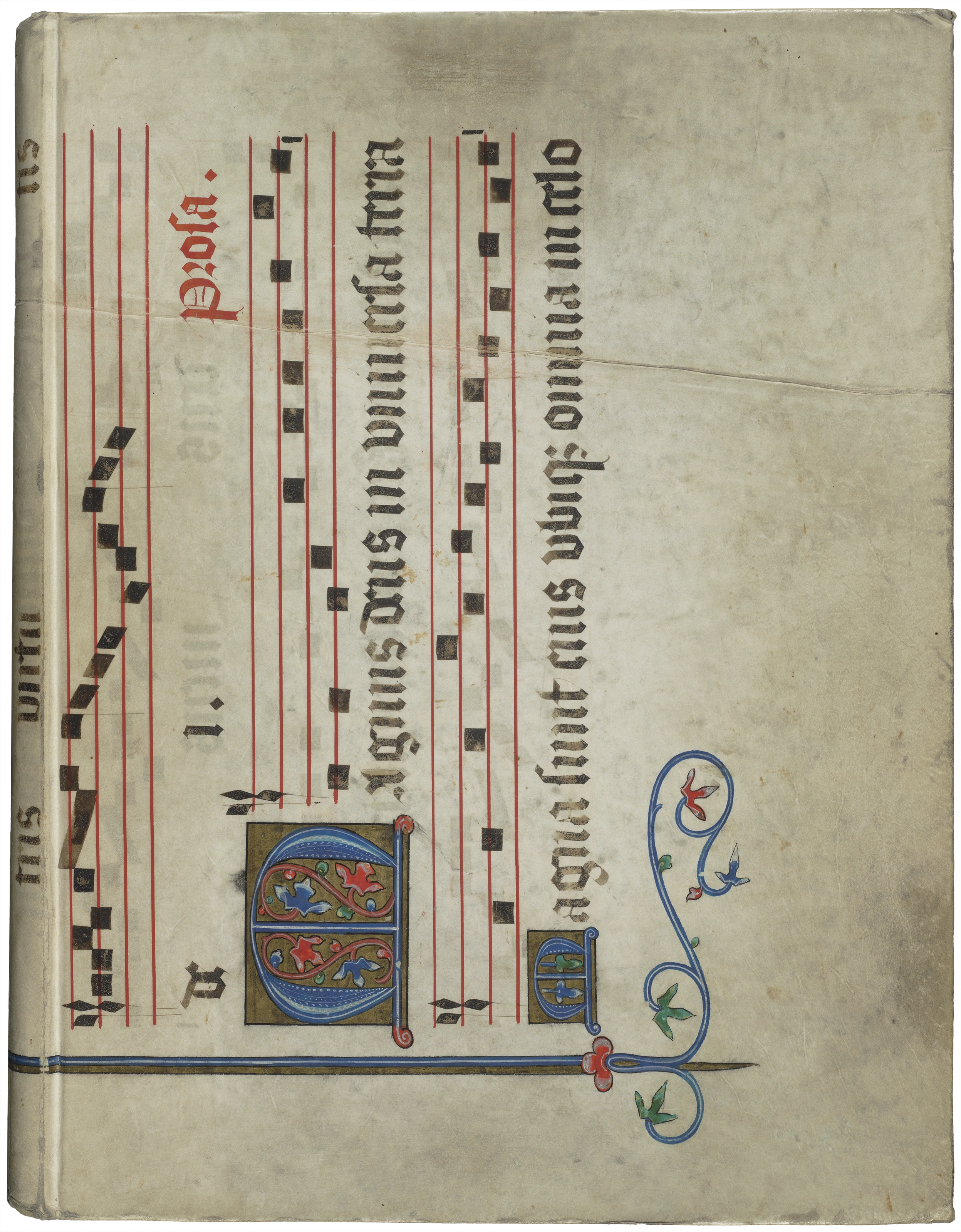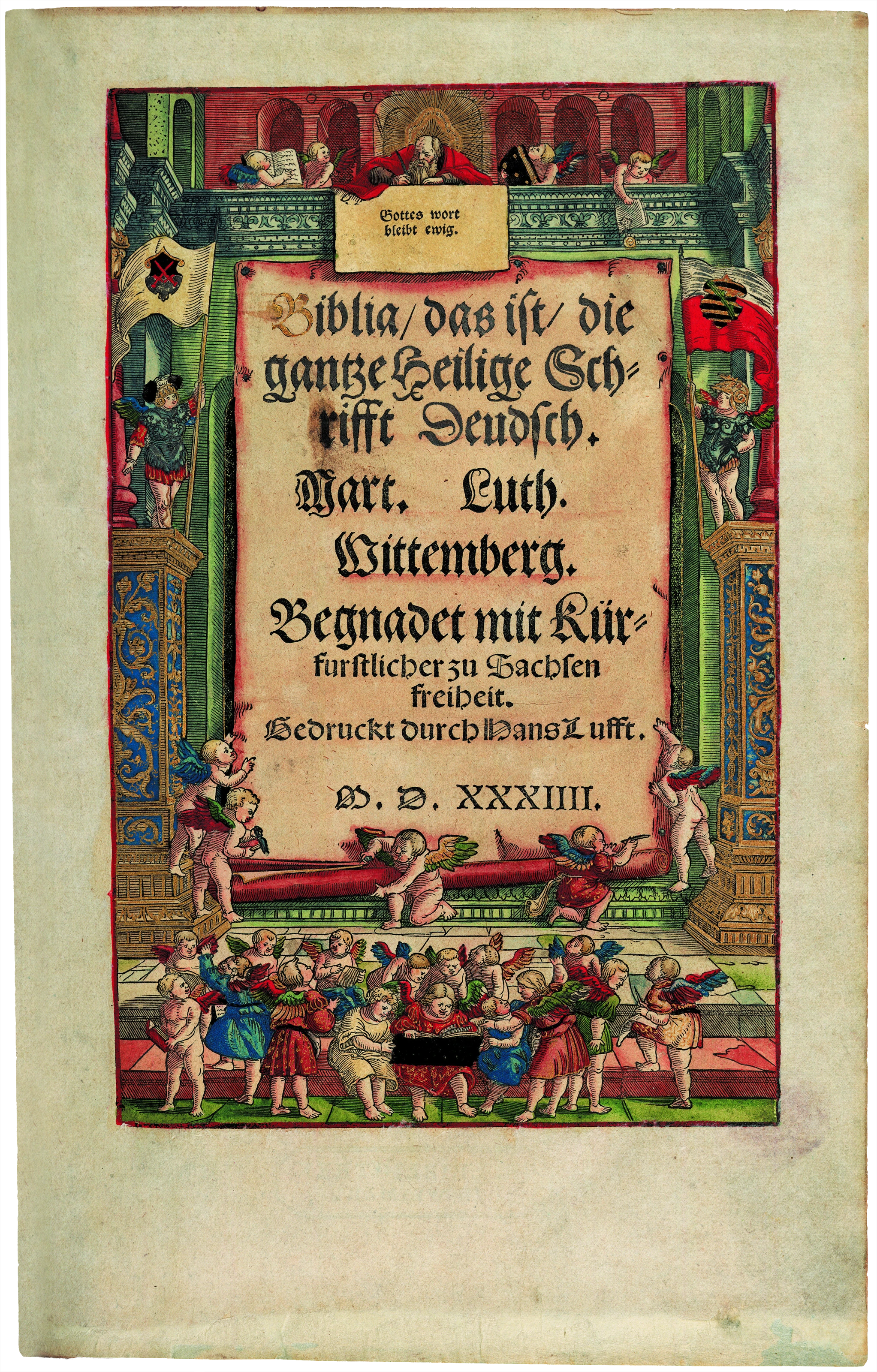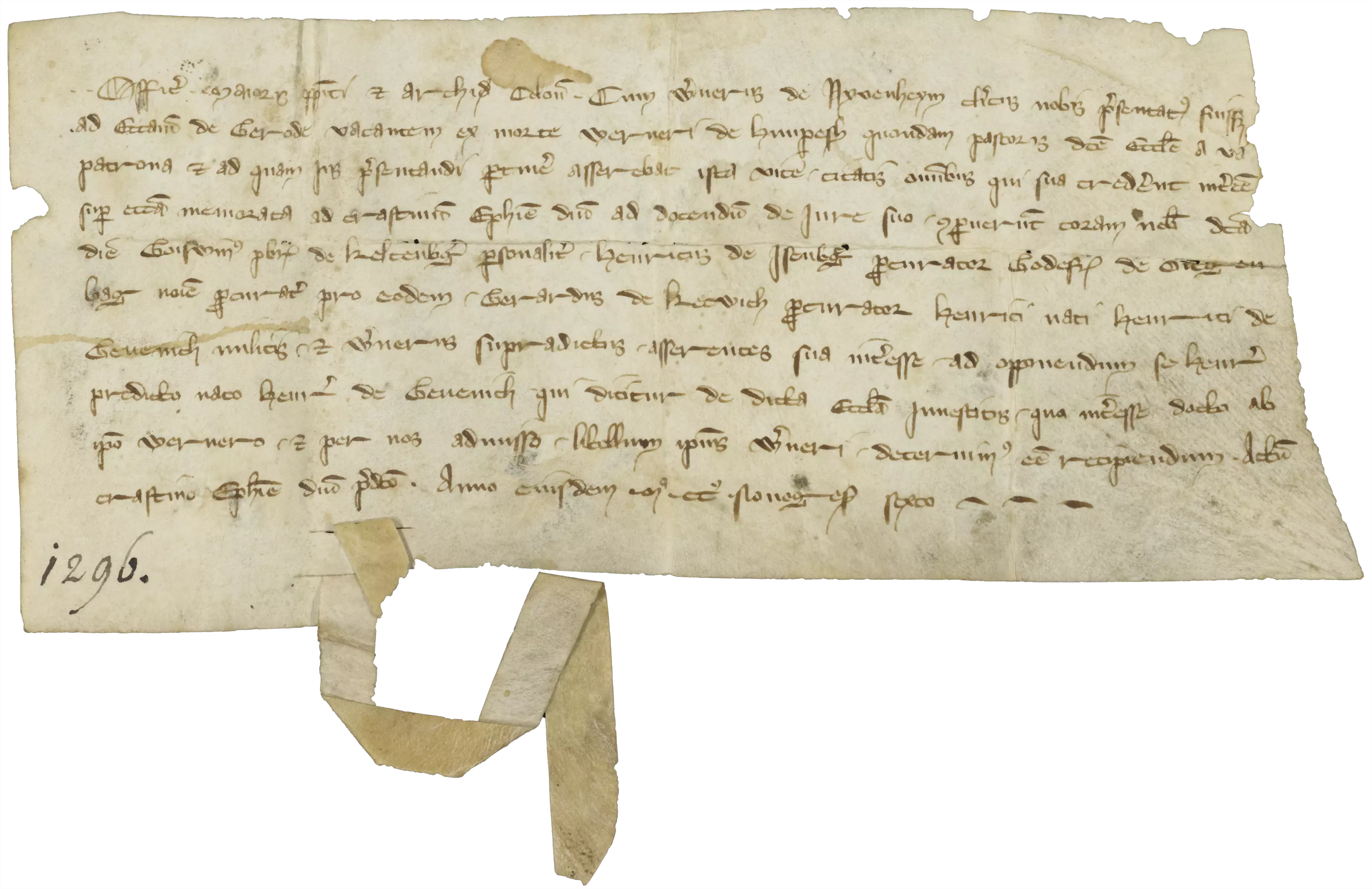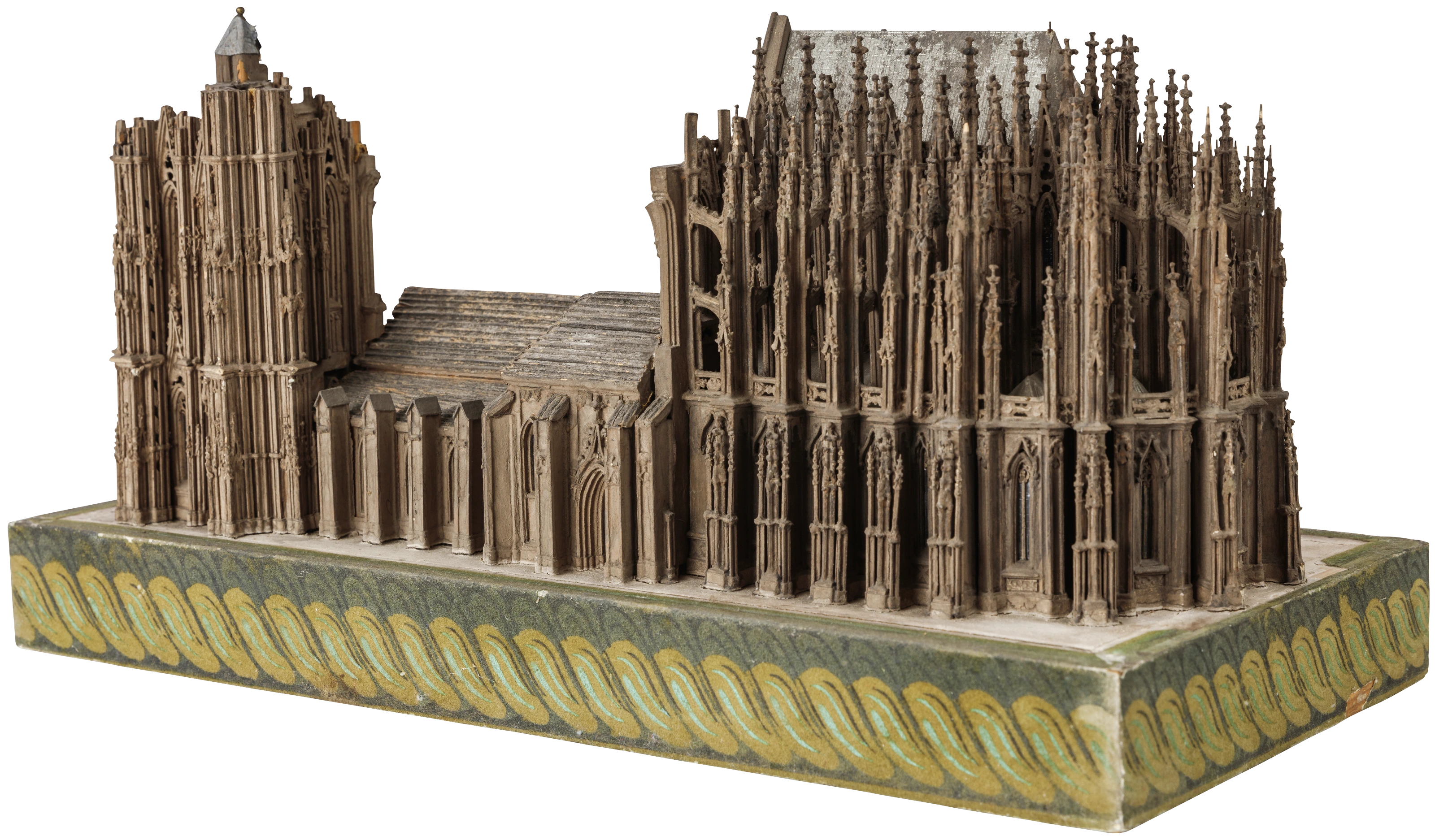Vorhaben der Klassik Stiftung Weimar werden gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Freistaat Thüringen, vertreten durch die Staatskanzlei Thüringen, Abteilung Kultur und Kunst.
Triptychon mit Einhorn-Verkündigung und Heiligen, um 1430/1440
Einhörner stehen für das Gute. Das Fabelwesen ist auch heutzutage äußerst beliebt. Fast sechshundert Jahre alt und von zeitloser Schönheit ist die Einhorn-Darstellung auf einem Altargemälde aus den Weimarer Sammlungen mittelalterlicher Kunst.
| Künstler | unbekannt |
| Titel |
Triptychon mit Einhorn-Verkündigung und Heiligen
[ GND ] |
| Standort | Mühlhäuser Museen, St. Marien (Leihgabe) |
| Entstehungszeit | um 1430/1440 |
| Objekttyp | Gemälde |
| Material / Technik | ölhaltige Temperafarben auf Fichtenholztafel, innen Leinwand |
| Weitere Metadaten | |
|---|---|
| Höhe | Mitte: 208,0 cm; linker Flügel 206,0 cm; rechter Flügel: 205,5 cm |
| Breite | Mitte: 121,0 cm; linker und rechter Flügel: 58,0 cm |
| Provenienz | 1829 im Inventar der Großherzoglichen Bibliothek nachgewiesen, 1909 dem Großherzoglichen Museum übergeben |
| Haltende Einrichtung | Museen |
| Sammlung | Gemäldesammlung / Mittelaltersammlung |
| Inventar-Nr. | G 119 |
| Links zum Objekt |
|---|
| Fotothek Online |
| Digitale Sammlungen der Museen |
| Copyright | Klassik Stiftung Weimar |
Sechs Jahrhunderte sind nicht spurlos an diesem Altargemälde vorübergegangen, und doch besticht es weiterhin durch seine feine und kostbare Malerei. Die mittlere Tafel zeigt eine Einhornjagd, wie sie im Thüringen des 15. Jahrhunderts ein beliebtes Thema für Altargemälde bot. Ein Einhorn flüchtet sich vor dem Erzengel Gabriel links und seinen Jagdhunden am unteren Bildrand in den Schoß der Jungfrau Maria im Zentrum. Sie sitzt in einem umzäunten Garten, dessen geschlossene Pforte Schutz bietet. Wachsam, aber gütig blickt Gottvater in der oberen linken Bildecke auf das Geschehen.
Die Darstellung allegorisiert die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria. Dafür stehen die geschlossene Pforte ebenso wie das Einhorn als Symbol Christi. Die mittelalterliche Darstellungsweise bedient sich einer symbolischen Bildsprache, wie wir sie aus modernen Comics kennen. Anstelle von Sprechblasen entrollen sich um die Figuren und Symbole der Mitteltafel weiße Spruchbänder, die zum Beispiel die Pforte beschreiben oder dem Erzengel die Worte in den Mund legen, mit denen er in der Bibel die Jungfrau Maria begrüßt.
Dass das Altarbild die Zeiten überdauert hat, ist nicht selbstverständlich. Erst zu Lebzeiten Goethes, als die Macht der Kirche stark zurückgedrängt wurde, begann man damit, mittelalterliche Objekte als Kunstwerke zu schätzen und zu sammeln. 1829 wurde das Altargemälde in der Kunstsammlung der Großherzoglichen Bibliothek erstmals erwähnt und stand damit am Anfang einer Mittelaltersammlung in Weimar.